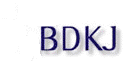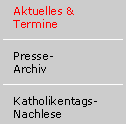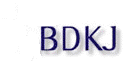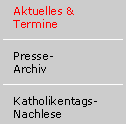|
ERSTER ARMUTS- & REICHTUMSBERICHT
Für Chancengleichheit
im Bildungssystem
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend in der Erzdiözese Hamburg beobachtet mit Besorgnis die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland. Bundesarbeitsminister Walter Riester (SPD) hatte am 25. April den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung vorgestellt.
Zwei Faktoren geben nach Ansicht der katholischen Jugendverbände besonderen Anlass zur Sorge. Noch immer sei eine höherwertige formale Bildung wesentliche Voraussetzung für erhöhte Erwerbschancen und eine ausreichende Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum. Aber gerade für Kinder und Jugendliche aus ärmeren Schichten der Bevölkerung sei das Bildungssystem zu undurchlässig, insbesondere gelte dies für Kinder und Jugendliche nicht-deutscher Herkunft. „Investitionen in ein verbessertes Schulsystem sind die beste Zukunftsvorsorge, damit der Teufelskreis von relativer Armut und schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt durchbrochen werden kann", betonte Timo Kotowski (22), BDKJ-Diözesanvorsitzender in einer ersten Reaktion.
Aus Sicht der katholischen Jugendverbände sind zum zweiten weitere Verbesserungen in der Familienförderung unbedingt erforderlich. „Es ist beschämend für ein reiches Land, wenn Kinder als Armutsrisiko betrachtet werden müssen," so Timo Kotowski. Zwar habe die Bundesregierung in den vergangenen zwei Jahren Schritte in die richtige Richtung unternommen, im Ergebnis seien diese aber noch nicht ausreichend. Neben einschneidenden Veränderungen im Steuersystem sei eine gesicherte Versorgung mit Ganztagskindergärten und -schulen eine wesentliche Voraussetzung für eine verbesserte Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Familie.
ERSTER ARMUTS- & REICHTUMSBERICHT
Arbeitsminister Riester
stellt Bericht vor
"Lebenslagen in Deutschland" lautet der Titel der Ersten Armuts- und Reichtumsberichtes der Bundesregierung, den Bundesarbeitsminister Walter Riester am 25. April 2001 in Berlin vorgestellt hat. Riester erklärte: "Ein reiches Land wie Deutschland muss wissen, wie die soziale Wirklichkeit ist und dies zur Grundlage politischen Handelns machen." Armut sei kein unabänderliches Schicksal.
Der Bericht könne dazu beitragen, einem weiteren Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Arm entgegenzuwirken und den Sozialstaat weiterzuentwickeln, so der Minister. "Der Bericht kann eine gute Grundlage für eine gezielte Politik zur Vermeidung und Beseitigung von Armut, zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verminderung von Polarisierungen zwischen Arm und Reich sein", sagte Riester.
Nach dem Bericht gab es 1995 in Deutschland etwa 13.000 Einkommensmillionäre. 229 von ihnen lebten im Osten. Das mittlere Nettoeinkommen dieser Personen lag bei 3 Millionen Mark. Das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen erhöhte sich im früheren Bundesgebiet von 23.700 Mark im Jahr 1973 auf 61.000 Mark im Jahr 1998. In der neuen Ländern betrug es 1998 etwa 47.4000 Mark pro Jahr. Das durchschnittliche Privatvermögen belief sich in westdeutschen Haushalten auf etwa 254.000 Mark, in den neuen Ländern waren es 88.000 Mark. Erwerbstätigkeit und das daraus resultierende Einkommen bestimmen wesentlich die Lebenssituation der Menschen. Unzureichende Qualifikation, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Probleme der Kinderbetreuung schränken den Zugang zur Erwerbsarbeit ein. Arbeitslosigkeit, insbesondere über einen längeren Zeitraum, bedeutet Einkommensverlust und kann zu Notlagen und sozialer Ausgrenzung führen. Arbeitslosigkeit lässt sich daher als Hauptrisikofaktor für Armut feststellen.
1998 gab es in Deutschland 13 Millionen Haushalte mit Kindern. Die meisten Familien bewältigen ihr Leben unabhängig, selbstständig und in sicheren materiellen Lebensverhältnissen. Familien geraten aber auch in Armutslagen. Einkommensarmut ist für den größeren Teil der Betroffenen ein vorübergehender Zustand. Vor allem junge Familien mit kleinen Kindern tragen ein erhöhtes Armutsrisiko. Die Entwicklung der 80er und 90er Jahre zeigt: Bei Ehepaar wie Alleinerziehenden steigt das Armutsrisiko mit der Kinderzahl überproportional an, wobei es mit zunehmendem Alter der Kinder wieder sinkt. Festzustellen ist allerdings auch eine Spreizung der Einkommen: Familien mit mehreren Kindern befanden sich überproportional häufig in den unteren und in den oberen Einkommensbereichen. Mit zunehmender Kinderzahl wurden für die Familien im unteren Einkommensbereich die Transferleistungen immer wichtiger zur Wahrung des Lebensstandards.
Auslösende Faktoren für Verarmungsprozesse von Familienhaushalten sind in erster Linie Arbeitslosigkeit und Niedrigeinkommen, Probleme der Konsum- und Marktverhaltens sowie besondere Lebensereignisse, vor allem infolge von Trennung bzw. Scheidung, aber auch infolge von Schwangerschaft und Geburt eines Kindes. Alleinerziehende Mütter und Mehrkinderfamilien geraten leichter in Armutslagen. Das Risiko, in dieser Lage zu verharren, ist für sie außerdem deutlich höher als für andere Bevölkerungsgruppen.
Armutsbericht im Download:
ARBBericht01.pdf
Daten und Materialien zum Bericht:
ARBDatenFakten.pdf
Stichwort
ERSTER ARMUTS- & REICHTUMSBERICHT
Der Armuts- und Reichtumsbericht beschreibt umfassend die soziale Lage in Deutschland in all ihren Facetten bis 1998. Mit der Veröffentlichung des Berichts setzt die Bundesregierung den Auftrag des Bundestages vom 27. Januar 2000 um und legt erstmals eine umfassende Bestandsaufnahme der sozialen Verhältnisse vor.
Dem Bericht liegt ein differenziertes Armutsverständnis im Sinne des Lebenslagenansatzes zugrunde, den auch die Europäische Union verwendet: Personen, Familien und Gruppen gelten dann als arm, wenn sie über so geringe materielle, kulturelle und soziale Mittel verfügen, dass sie von der allgemein üblichen Lebensweise ausgeschlossen sind. Auf der Grundlage dieses Verständnisses wird Armut unter einer Reihe von Gesichtspunkten, etwa relativer Einkommensarmut, kritischen familiären Lebensereignissen, sozialen Brennpunkten in Großstädten, Obdachlosigkeit oder Überschuldung, betrachtet. Reichtum wird angesichts des erst in Ansätzen entwickelten Forschungsstandes und der begrenzten Datenlage vor dem Hintergrund der Einkommens- und Vermögensverteilung beschrieben.
|
|