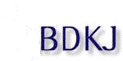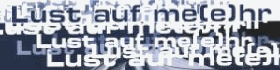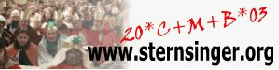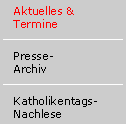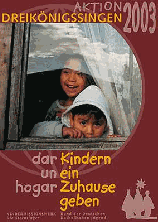|
„Dunkle Provinz,
schroffe Geographie"
02-12-12
Trocken und heiß im Norden, kühl und feucht im Süden, hohes Wirtschaftswachstum und Kinderarmut, private Universitäten und kaum gebildete Landarbeiter. Chile, das Beispielland der Aktion Dreikönigssingen 2003, ist ein Land der Gegensätze.
„Ich komme aus einer dunklen Provinz, aus einem Land, das die schroffe Geographie abgeschnitten hat von allen anderen".
So beschrieb Literaturnobelpreisträger Pablo Neruda bei seiner Auszeichnung seine Heimat, das lateinamerikanische Chile. Auf der einen Seite durch das Meer und die Küstenkordillere und auf der anderen Seite durch die Anden begrenzt, ist das Land etwa 5200 km lang und durchschnittlich nur 180 km breit.
Beinahe alle Klimazonen sind in Chile zu finden. Der große Norden beherbergt die trockenste Wüste der Welt, die Atacama-Wüste. Hier sind die großen Kupferminen und die Geisterdörfer, die nach der Schließung der Salpeterminen übrig geblieben sind, zu finden. Der Norden besteht aus Steppe. Dort wo der Boden bewässert wird, werden subtropische Früchte, Trauben und der typisch chilenische Pisco angebaut. Auch die grüne Zentralregion um die Hauptstadt Santiago ist bekannt für den Weinanbau. Hier befindet sich auch die „Carretera de la Fruta", die Obststraße, an der sich die großen Obst- und Gemüseplantagen entlang ziehen. Das Klima ist hier etwa wie im Süden Europas, mit langen Sommern, kurzen, trockenen, aber kalten Wintern. Im Süden regnet es etwa acht Monate im Jahr, die Temperaturen sinken im Winter jedoch selten unter den Gefrierpunkt.
Etwa 15 Millionen Menschen leben in Chile. Die meisten von ihnen haben sich in den Großstädten des Landes niedergelassen. Allein in der Hauptstadt wohnen 4,5 Millionen. Nur 14% der Chilenen leben noch auf dem Land. Die Chilenen sind zum großen Teil Mestizen. 7,5% der Bevölkerung bilden die indigenen Völker. Dazu gehören die Atacamenos, Aymara, Diaguitas und Kolla im Norden, die Rapa Nui auf der Osterinsel und die Mapuche, Yagán und Ona im Süden.
Seit 13 Jahren ist die Militärdiktatur unter General Pinochet abgesetzt. Seitdem hat ein starkes Wirtschaftswachstum dazu geführt, dass in den Industrienationen kaum noch jemand Chile als Entwicklungsland bezeichnet. Die Armut hat der wirtschaftliche Aufschwung aber nicht beseitigt. Immer noch lebt jedes dritte chilenische Kind in Armut. Die Schere zwischen Arm und Reich hat sich weiter geöffnet. Die reichsten zehn Prozent der Chilenen verdienen mehr als 40 Prozent des Gesamteinkommens, während dem ärmsten Zehntel weniger als zwei Prozent des Volkseinkommens zufallen.
Sozialer Aufstieg ist in der chilenischen Gesellschaft ein beschwerlicher Weg. Das Schulsystem ist teilweise privatisiert. Wer studieren will, um einen guten Beruf zu erlernen und aus dem Teufelskreis der Armut auszubrechen, muss viel Geld bezahlen. Mindestens 100,- Euro monatlich kostet der Besuch einer Universität. Höherwertige Bildung ist nur privaten Schulen zu erwerben. Die öffentlichen Schulen sind von Bildungsnotstand gekennzeichnet. Schlecht bezahlte Lehrer müssen häufig vor Klassen mit mehr als 50 Kindern unterrichten.
Kinder auf dem Land haben es doppelt schwer. Sie müssen lange, beschwerliche Wege in die kleinen Landschulen zurücklegen. Da viele Kinder zu Hause auf dem Land als Arbeitskräfte gebraucht werden, gehen nur wenige länger als acht Jahre in die Schule. Sie haben es dann später sehr schwer eine Arbeit zu finden, da auch in Chile heutzutage für die meisten Tätigkeiten eine vollständige Schulbildung nötig ist.
|
|